|
Bis zum Nichts
Massimo Carboni, Dozent für
Ästhetik, Akademie der Schönen Künste Florenz
- Auszug -
Künstlerische Praxis ist organisierte Anomalie. Sie ist sprachlich
diszipliniert. Jenseits davon gibt es nur Geschwätz über „Kreativität“. Die
Arbeit von Paolo Monti umkreist beständig – und schon seit einiger Zeit – diese
Evidenz und dieses Bewusstsein mittels eines instrumentellen Filters (und eines
Codes), der von der prosaischsten Handfertigkeit bis zur hochgezüchtetsten
wissenschaftlich-technologischen Apparatur reicht. Vielleicht erscheint er
gerade deshalb als katalytischer Drehpunkt (oder Verteiler?) einer Reihe von
Bezügen, fundamentalen Problemen und Fragen, die sich auf zwei getrennte, aber
eng miteinander verknüpfte, konzeptuelle und operative Bahnen verteilen.

Auf der einen Seite die Arbeit über das Geld, und daher über den Fetischismus
des Wertes: Verlangen nicht nach der Sache, sondern nach dem Verlangen selbst.
Schwindlige Höhen der vollständigsten Abstraktion, der fleischlosesten
Virtualität und gleichzeitig der größtmöglichen faktischen Operativität. Der
theoretisch-konzeptuelle Bogen reicht von Marx bis Simmel. Monti nimmt sich also
konzeptionell und materialisch das Geld zum Gestaltungsobjekt: Figur seiner
selbst und gleichzeitig des Anderen, höchster Wertausdruck, Mythologie des
Mythos. Aber welche Elemente werden ins Spiel gebracht?
<<Der Tauschwert der Ware, als besondere Existenz neben der Ware selbst>>,
schreibt Marx in den Grundrissen, <<ist Geld; ist die Form, in welcher alle
Waren gleichwertig sind, sich konfrontieren und sich messen; ist das, worin sich
alle Waren auflösen, das, was sich selbst in allen Waren auflöst.>> Die Arbeit
von Paolo Monti scheint gleichzeitig die Paraphrasierung und die wörtliche
Umkehrung der marxistischen These zu sein. Das Geld wird tatsächlich nicht als
Form oder Mittel und folglich als allgemeines Äquivalent angenommen, sondern
wird als Material einem Verfallsprozess unterworfen: es lösst sich nicht in der
Ware auf, sondern in sich selbst. Das abstrakte Zeichen regrediert zu konkreter
Tatsächlichkeit, Gestalt, (zeitlicher) Gegenwart. Geld ist seiner Natur nach
keine Ware mit intrinsischem Wert, seine Qualität besteht exklusiv in seiner
Quantität. Monti materialisiert den abstrakten Wert, das Phantasma; er kehrt den
Prozess um, welcher zum Auschluss der Ware führt, die als Geld fungiert, und
daher zur Bildung des allgemeinen Äquivalentes führt. Dabei wird die Ware auf
den ursprünglichen Material-Objekt-Zustand mit seinem extremen, residuellen
Gebrauchswert zurückgeführt. Zum Zeitpunkt x, wird sich die Banknote unter der
Attacke von Säuren spurlos auflösen. „Zeit ist Geld“ sagt man. Hier ist es das
Geld, welches Zeit ist. Bis zum Erreichen der totalen Entropie, bis zum finalen
Konsum, bis zum Nichts.
Andererseits, gibt es im Schaffen Montis viel spezifischere Anlehnungen an
naturwissenschaftlich-erkenntnistheoretische Verfahren, die sich auf eine
hyper-technologische Dimension konzentrieren und fundamental verwurzelt sind in
den Prinzipien der sinnlichen Wahrnehmung und in den von ihr aufgeworfenen
Fragestellungen zu den Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt, und zwischen
Identität und Alterität. Dass schliesslich das „Objekt“ in Wahrheit eine Welt
ist, ein Sinn-Horizont, und dass deshalb eine ethische Erfahrung entsteht, steht
auf einem anderen Blatt. Tatsächlich ist es der Andere, welcher uns
konstituiert; ohne zu vergessen, dass offensichtlich wir selbst die Anderen für
die Anderen sind. Ohne solche Distanz kann keine Nähe entstehen.
Alle diese Dinge sind wohl bekannt. Hier werden sie in sehr synthetischen
Termini nur deshalb in Erinnerung gerufen, weil sie – noch mehr als es beim
ersten Hinsehen scheinen mag – etwas mit der hochentwickelten technologischen
Arbeit von Paolo Monti zu tun haben. Die Themen sind genau jene der Beziehung
zwischen Identität und Alterität, zwischen Subjekt und Objekt: mit ihrem
reziproken Austausch und Abweichen, mit ihren kognitiven Labyrinthen, die einen
an den anderen binden. Eine interaktive Praxis, in der der Betrachter die
Manifestation des Werkes als solche möglich macht.
Gewiss, in der Arbeit von Paolo Monti offenbart sich das “Wunderbare”, das
(hyper) technologische thaumazein: zwar auf verschiedenen Ebenen der Macht und
der Verführung, aber es offenbart sich zweifellos. Tatsächlich werden die
technologischen Prozesse (basierend auf Physik und Chemie) einfach gezeigt, ohne
eine besonders eindringliche Bearbeitung seitens des Künstlers. Monti ist nicht
auf der Suche nach der „immaginativen“ oder „ästhetischen“ Seite der Technik; es
gibt bei ihm keinerlei pathetische Anmassung ideologischer Natur, die Technik
humanistisch „zu erlösen“ durch Nachweis ihrer „Poesie“ oder „Kreativität“. Hier
wird die Technologie in einer Weise genutzt, durch die sie autonom und spontan
das eigentliche thaumazein produziert. Damit das aber auch zustande kommt, ist
es nötig, sie – mit Duchampschem Gedächtnis – „in Stellung zu bringen“. Und das
kann nur ein Künstler leisten.
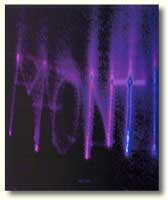 Massimo Carboni, Professor für Ästhetik an der Fakultät für Kunst und
Kultur der Universität Tuscia in Viterbo und der Accademia di Belle Arti in
Florenz, Italien. Massimo Carboni, Professor für Ästhetik an der Fakultät für Kunst und
Kultur der Universität Tuscia in Viterbo und der Accademia di Belle Arti in
Florenz, Italien.
Auszug aus:
“Bis zum Nichts” /
“Until Nothingness”
/ „Fino
al nulla“ in Paolo Monti (Musis, 1998) -
ISBN 88-87054-01-0, in der vorliegenden Textsammlung produziert für die
personale Kunstausstellung von Paolo Monti,
Vierdimensional², Konstanz (D), 2001. |