|
PAOLO MONTI: VOM PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN
EXPERIMENT ZUR KUNST
14| k u n s t u n d k u l t u r
|
uni’kon | Alexia
Sailer II.2001
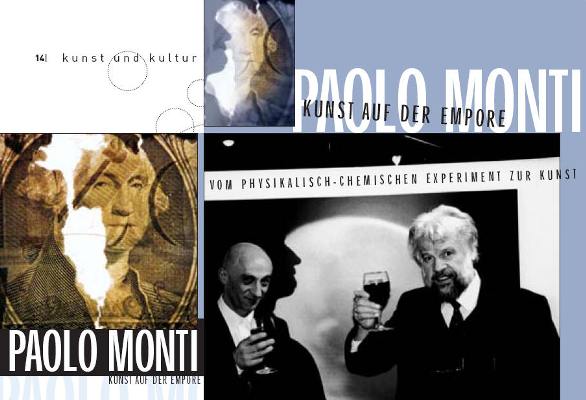
Die Figur scheint durchsetzt zu sein von geheimnisvollen Kraftfeldern.
Orangegelbe wolkenartige Strukturen füllen Gesicht und die nackten Arme der
Gestalt aus. Hemd und Mütze sind zu erkennen, definiert durch blaulila gefärbte
Flächen.
Die Erkenntnis dämmert: Das Bild eines Menschen, mit einer Thermokamera
aufgenommen, ist hier zu sehen. Das Prinzip dieses Aufnahmeverfahrens: Die
Wärmekamera bildet sozusagen Temperatur ab; je wärmer ein Objekt, desto mehr
geht dessen farbliche Darstellung auf dem Kamerabild über in ein dunkles Orange.
Je kälter, desto mehr geht die Farbe ins Blaue über. Ist das zu Bild gewordene
wissenschaftliche Erkenntnis, was da in der Galerie der Universität auf der
Empore ausgestellt wurde? Ja. Aber nicht nur.
»Vierdimensional« lautete der Ausstellungstitel des Italieners Paolo Monti.
Einer Ausstellung, die Wissenschaft, oder besser: Experiment und Kunst
zusammenführte.
Die Wärmebilder sind ein Teil des Oevres von Monti aus den 90er Jahren. Porträts
schafft Monti in dieser Technik. Allerdings nicht mehr Porträts, die eine Person
in ihrem unverwechselbaren Äußeren abbilden und dabei vielleicht sogar gewisse
charakteristische Eigenschaften im Bild festzuhalten versuchen. Monti erzeugt
mit Hilfe des wissenschaftlichen Experiments unter Einsatz von
Quecksilberspiegeln überindividuelle, da nicht mehr an eine Persönlichkeit
gebundene, Porträts.
Stellt sich die Frage: Was ist Kunst bei Monti? Die Antwort ergab sich etwa in
einem Werk, in dem der Schatten des Künstlerprofils vor dem Profil des Künstlers
in Wärmedarstellung steht. Eine Anspielung auf die Anekdote vom Beginn der
Malerei, als eine Frau den Schattenriss ihres Geliebten zeichnete, als dieser in
den Krieg zog.
Konzeptkunst führte Monti vor, »à la Duchamp«, wie Friedemann Malsch, Direktor
des Kunstmuseums Liechtenstein, zur Einführung der Ausstellung erklärte. Dies
wurde auch im zweiten Werkkomplex, mit dem sich Monti beschäftigt, deutlich:
Geld. Oder besser: Zersetzung oder Zerfall von Geld. Arbeiten wie die
Installation »Riechen Sie daran....« machen Spaß und atmeten durchaus
Hintersinn. Die Zersetzung einer Dollarnote zu beobachten und daneben Zeugnisse
des auf Cibachrome gebannten Verfalles des Geldes zu sehen, erweckte Neugierde
und ist natürlich mit vielen Implikationen behaftet. Doch war es nicht
vielleicht etwas hoch gegriffen, Monti in einem Zug mit der Innovation und den
vielschichtigen, hochreflexiven Bedeutungshorizonten eines Marcel Duchamp zu
nennen?
Der Konstanzer Wirtschaftswissenschaftler Prof. Nikolaus Läufer brachte Montis
Werk mit einem Geldtheorie-Konzept in Verbindung. Er erinnerte an das sogenannte
Schwundgeld, das in den dreißiger Jahren, so Läufer, von Silvio Gesell erfunden
wurde. Die Sorge damals: Geld sparen schadet der Wirtschaft. Um die Ökonomie
anzukurbeln, musste das Geld einem geplanten Verfall ausgesetzt werden - damit
die glücklichen Geldbesitzer ihren Reichtum auch gleich wieder investierten,
bevor er verfällt.
Die Implikationen waren deutlich: Auch Paulo Monti produziert eine Form von
Geldschwund; einmal zerstörte sich das Geld durch chemische Zersetzung quasi
selbst, im Falle von »Riechen Sie daran...« wurde der Betrachter aktiv durch
Knopfdruck zum Zerstörenden - und natürlich hatte der Künstler selbst in
Arbeiten wie den in eine Plexiglasplatte gegossenen, aneinandergereihten oberen
Rändern von 50.000 Lire-Scheinen seine Hände im Spiel.
Spätestens bei dieser Arbeit jedoch wurde bei Monti aus Geldverfall »wie durch
Zauberhand« Geldvermehrung, wie Friedemann Malsch bei der Vernissage schmunzelnd
erklärte: Paulo Monti ging mit den ihres Randes beschnittenen Geldscheinen zur
Bank - und tauschte sie kurzerhand gegen neue aus.
Alexia Sailer
|